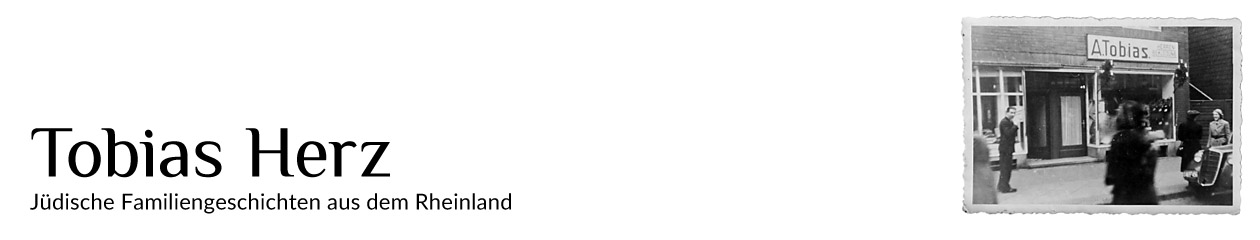Am 4. Februar 2015 waren am Humboldtgymnasium Solingen eine Überlebende des Holocaust und eine Zeitzeugin der zweiten Generation zu Gast, um den Schülern von ihren Erfahrungen zu berichten. Die Begegnung fand auf Vermittlung des Rutenberg-Instituts (Haifa) und der Initiative „NRW für Israel“, (Düsseldorf) statt.

In der Mediothek des Humboldtgymnasiums ist an diesem Morgen jeder Stuhl besetzt. Über 70 Schüler warten auf den angekündigten Besuch aus Israel. Die 15- bis 17-jährigen sind Teilnehmer des Austauschs mit einer Partnerschule in Tel Aviv, Schüler zweier Religionskurse und eines Geschichtskurses, der im Mai nach Auschwitz fahren wird. Für sie ist das Thema „Holocaust“ nicht neu. Die Begegnung mit Menschen, die die Verfolgung noch selbst erlebt haben, weckt jedoch angesichts des heute hohen Alters der Überlebenden besondere Erwartungen. „Wir sind das, womit wir uns beschäftigen, was wir an uns ranlassen,“ sagt Lehrer Rolf-Joachim Lagoda zur Begrüßung.
Vorne am Tisch nehmen drei Frauen Platz: Silvi Behm, Leiterin des Rutenberginstituts in Haifa, Shoshana Direnfeld, 1928 in Cluj/Klausenburg (Siebenbürgen) geboren, und Pnina Kaufmann, 1946 im polnischen Lodz geboren. Shoshana Direnfeld fängt an, mit leiser aber fester Stimme von ihrer Kindheit in Klausenburg zu sprechen, dem schönen Haus, in dem die Familie lebte. Acht Geschwister waren sie. 1940 kamen die Deutschen und nahmen den Juden alles weg. „Wir hatten kein Radio mehr, Zeitungen gab es für uns auch nicht. Wir wussten nichts von dem, was Hitler in den anderen Ländern mit den Juden machte.“ Gerüchte gab es wohl, aber ein österreichischer Offizier, der in der Nachbarschaft wohnte, beruhigte sie: „Sowas wird es hier nicht geben, keine Sorge.“ Am Tag bevor der Befehl gegeben wurde, alle Juden in ein Ghetto zu sperren, verschwand der Offizier.
Es war am 15. März 1944, als bereits Millionen Juden im Osten umgebracht und die Niederlage Deutschlands absehbar war, als die SS nach Klausenburg kam und die Internierung der jüdischen Einwohner anordnete. Im Ghetto brach nach einiger Zeit Typhus aus, und man sagte den Juden, sie werden in ein besseres Lager überführt, wo sie arbeiten können. Am 9. Mai 1944 wurden sie in einen Zug verladen, je 120 Mann in einen Waggon, ohne Nahrung, Wasser und Toilette. Der Zug fuhr über 3 Tage bis Auschwitz.
„Wie alt bist Du?“ – „15.“ – „Geh rechts!“ Shoshana und drei ältere Geschwister schickte Dr. Mengele nach rechts, die kleineren Geschwister nach links. Sie sahen sie nie wieder. Während sie auf die Zuordnung zu einem Block warteten, spielte das Häftlings-Orchester zur Ablenkung Musik. Dann hieß es: „Vergesst Eure Namen, ihr bekommt jetzt Nummern.“ Es waren so viele Menschen auf einmal angekommen an diesem Tag, dass sie vergaßen, Shoshana ihre Nummer auf den Arm zu tätowieren, aber sie hat sie bis heute behalten. Die Zustände in Auschwitz-Birkenau waren schrecklich. Ein Topf Suppe für 12 Menschen, jeder nur einen Schluck. Ein Bretterboden als Bett für 12 Menschen. Stundenlange Zählappelle im Schnee. Der unheimliche Dr. Mengele, der Experimente an Kindern durchführte.
Irgendwann kam ein tschechischer Ingenieur ins Lager und suchte nach Arbeitskräften für eine U-Bootfabrik. Shoshana wurde ausgewählt. Im neuen Arbeitslager waren sie zwar besser untergebracht, mussten aber 12 Stunden am Tag arbeiten, sich danach um ihr Essen und ihre Wäsche kümmern. Nur 3 Stunden blieben für Schlaf. „Ein paar Leute sind davon verrückt geworden. Eine Frau hat den ganzen Tag gebetet, immer denselben Satz.“ Als Auschwitz schon befreit war, kam eines Tages Dr. Mengele in das tschechische Lager. Die Frauen versuchten ein neu geborenes Baby vor ihm zu verstecken, aber es fing an zu weinen. Mengele schickte die Mutter, ihr Kind und die „Verrückten“ nach Theresienstadt. Als sie dort ankamen, war das Lager schon befreit und sie haben überlebt. Die U-Bootfabrik wurde am 9. Mai 1945 befreit. Es herrschte Chaos. Die Russen wussten nicht, was sie mit den halbverhungerten Menschen anfangen sollten, die sie dort fanden.
Shoshana kam schließlich zurück nach Cluj, aber es war nichts mehr geblieben von ihrem zu Hause. „In der Garage war eine Kiste, die mein Vater vor der Deportation dort vergraben hatte. Das war alles.“ Der Vater war in einem Arbeitslager in Buchenwald umgekommen, die Mutter und die vier jüngeren Geschwister in Auschwitz. Die älteren trafen sich in Cluj. Zuletzt kam eine Schwester, als keiner mehr daran glaubte. Das Leben in Rumänien war für die Geschwister nicht einfach. Sie besaßen nichts mehr, hatten ihre Schulzeit verpasst und das neue kommunistische Regime machte den Juden das Leben ebenfalls nicht leichter. Erst 1959 bekam Shoshana nach mehreren Anläufen die Ausreiseerlaubnis für Israel. In Haifa heiratete sie und bekam drei Kinder. „Ich kann bis heute nicht verstehen – warum?“
„Was haben sie voher schon von Hitler mitbekommen?“ will ein Schüler wissen. „Nichts,“ antwortet Shoshana Direnfeld. Man glaubte zunächst, das sei alles weit weg und beträfe sie nicht. Als dann die Deutschen kamen, wurden die Juden von allen Informationskanälen abgeschnitten. Deswegen sei auch keiner auf die Idee gekommen zu fliehen. Und wohin auch? Die meisten Länder versuchten damals die jüdischen Flüchtlinge abzuwehren. Silvi Behm ergänzt: „Es gibt nur ganz wenige Familien, die schon 1933 so hellsichtig waren Deutschland zu verlassen. Die Juden fühlten sich doch in erster Linie als Deutsche und wollten nicht weg.“

Pnina Kaufmann (68) zählt zur zweiten Generation. „Was bedeutet das?, werde ich oft gefragt. Es bedeutet, dass es nicht vorbei ist. Auch wir Kinder haben die Hölle der Eltern durchgemacht.“ Ein Jahr nach Kriegsende kam sie im polnischen Lodz zur Welt. Pninas Eltern konnten sich nicht von ihren Erlebnissen distanzieren. Jeden Tag redeten sie von den Grausamkeiten, die sie nicht verarbeitet hatten, in allen Details. „Es war eine via dolorosa: zu Hause die verstörten Eltern, in der Schule die Diskriminierung als Jüdin.“ Der Antisemitismus in Polen blieb auch nach dem Krieg virulent. Ihr Vater wollte daran glauben, dass im Kommunismus endlich alle Menschen gleich sein würden, aber diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Nachdem man ihm auf offener Straße die Nase gebrochen hatte, konnte die Mutter sich endlich durchsetzen mit dem Wunsch, nach Israel zu gehen. 1957 zog die Familie in den neuen jüdischen Staat am Mittelmeer.
„Ich wurde mit 10 Jahren als Mensch neu geboren. Man nannte mich bei meinem Namen und nicht mehr ‚dreckige Jüdin‘. Ich durfte stolz sein und mich wehren,“ beschreibt Pnina, was der Staat Israel ihr gegeben hat. Die Jugendlichen in Israel fingen damals an, ihre Eltern zu hinterfragen. Sie schämten sich dafür, dass sich ihre Eltern nicht gewehrt hatten. „Ich habe rebelliert, ich konnte es nicht anders ertragen.“ Als sie später verstand, warum die Eltern dem Naziterror nichts entgegenzusetzen hatten, kam das schlechte Gewissen. „Das habe ich bis heute.“ Für einen kurzen Moment versagt ihre Stimme, sie blickt zur Seite.
Die lebenshungrige junge Frau lernte nach dem 6-Tage-Krieg in Eilat einen jungen Deutschen kennen und lieben. Als sie ihrem Vater gestand, dass sie ihn heiraten wollte, sprach er ein halbes Jahr lang nicht mehr mit ihr. „Aber meine Eltern haben sich schließlich doch damit arrangiert und uns auch regelmäßig in Deutschland besucht.“ Bei einem dieser Besuche hörte sie ihren 90-jährigen Vater nachts weinen. Erst da erfuhr sie, dass er denselben Alptraum aus Auschwitz jede Nacht durchmachte: wie er sich nach einer Massenerschießung verwundet aus einem Berg von Leichen befreit. „Meine Mutter hatte einen Sauberkeitsfimmel. Es war überlebenswichtig im Lager, sich auf keinen Fall gehen zu lassen.“ Sie hofft, dass sie ihren eigenen Sohn vor seelischen Schäden so weit wie möglich bewahren konnte. Für sie selber war es ein harter Kampf, sich der Hölle der Eltern zu erwehren. „Israel hat dabei für mich eine wichtige Rolle gespielt.“ Deswegen empfindet sie Kritik am Staat Israel häufig als modernen Antisemitismus. „Aus den Medien bekommt man kein realistisches Bild von Israel. Wenn ich die Situation nur aus den Medien kennen würde, würde ich auch denken, das ist ja schlimm, was da passiert. Aber Ihr müsst kommen und das Land kennenlernen, sonst versteht ihr es nicht,“ fordert sie die Schüler auf. Shoshana Direnfeld legt ihr die Hand auf den Arm. „Wir wollen nicht politisch werden,“ beschwichtigt sie.
Eine Schülerin will wissen, wie es für Pnina Kaufmann ist, in Deutschland zu leben. „Als ich 1973 hierher kam, war ich überzeugt, dass es ein anderes Deutschland sei. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher wie damals. Aber ich lebe immer noch gerne hier.“ Ob sie noch einmal nach Polen gegangen sei, fragt eine andere Schülerin. „Eigentlich wollte ich nicht, aber dann wurde ich als städtische Angestellte gebeten, bei einer Reise in die polnische Partnerstadt zu dolmetschen. Ich habe mich zunächst gewehrt, aber dann doch zugesagt. Es war okay.“ Bei der zweiten Reise wollte sie unbedingt nach Auschwitz – und überschätzte ihre Kräfte. „Ich bin komplett zusammengeklappt.“
Die eigenen Grenzen zu erkennen ist ein schwieriges Unterfangen. Shoshana Direnfeld hat erst vor zwei Jahren damit begonnen, für das Rutenberg-Institut als Zeitzeugin zu sprechen. Ihre Kinder haben sie in dem Entschluss bestärkt. „Aber mit ihnen habe ich nie über Auschwitz geredet. Ich kann ihnen das nicht zumuten,“ sagt sie kategorisch. Wichtig ist beiden Frauen, dass sich die Jugendlichen nicht schuldig fühlen, aber Verantwortung übernehmen und gegen Diskriminierung und Hass einstehen, damit sich Geschichte nicht wiederholt. „Mir kommt es selber oft unwirklich vor, was ich erlebt habe,“ gibt Shoshana Direnfeld zu. Umso wichtiger, dass sie sich entschieden hat, Zeugnis abzulegen, von dem, was damals wie heute kaum fassbar scheint und doch passiert ist.
Besonders für die Schüler, die am Austausch mit den israelischen Jugendlichen teilnehmen werden, ist es wichtig, auf die individuellen emotionalen Untiefen vorbereitet zu sein, findet Lehrerin Ingrid Bruchhaus. „Wir haben schon erlebt, dass sich israelische Großeltern zunächst weigerten, den deutschen Gastschüler ihres Enkels kennenzulernen. Am Ende kam es zu herzzerreißenden Versöhnungsszenen. Das kann einen schon umhauen.“